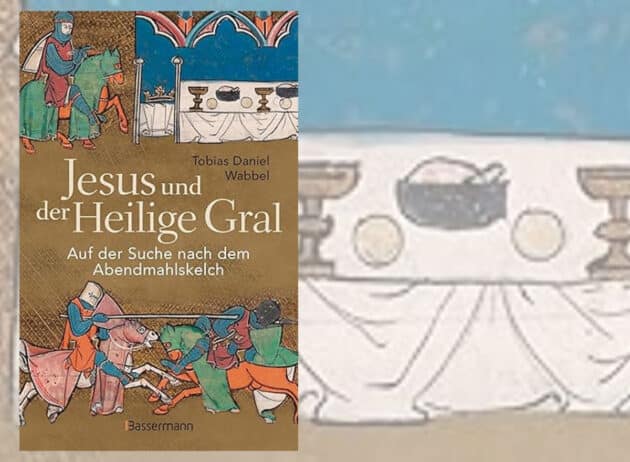Neue Analyse von Apollo-Gesteinsprobe datiert bedeutendes Kapitel der Mondgeschichte vor
Livermore (USA) – Mehr als 50 Jahre nach der Rückkehr der Apollo-17-Mission sorgt ein kleines Stück Mondgestein erneut für eine wissenschaftliche Überraschung. Die unscheinbare Probe mit der Katalognummer 76535 erweist sich als Schlüssel, um ein ganzes Kapitel der Frühgeschichte des Mondes – und damit auch der Erde – neu zu schreiben.

Copyright: NASA
Inhalt
Kleine Probe – Großes Rätsel
1972 entnahmen die Apollo-Astronauten die nun erneut untersuchte Gesteinsproben im Taurus-Littrow-Tal auf der erdzugewandten Seite des Mondes. Analysen zeigten früh: Das Gestein bildete sich rund 50 Kilometer unter der Oberfläche, tief in der Mondkruste. Auffällig war jedoch, dass es keinerlei Spuren jener extremen Schockwirkungen trägt, die man üblicherweise erwartet, wenn solch tief liegendes Material durch gewaltige Einschläge an die Oberfläche geschleudert wird. Jahrzehntelang rätselten Forscher, wie das Gestein seinen Weg nach oben gefunden haben könnte.
Eine gängige Erklärung lautete, es sei durch den katastrophalen Einschlag entstanden, der das gewaltige South-Pole–Aitken-Becken auf der Mondrückseite formte – das größte bekannte Einschlagbecken im Sonnensystem. Doch diese Theorie hatte Schwächen: Der Transport des Gesteins über die halbe Mondkugel hinweg, ohne dabei Schockspuren zu hinterlassen, erschien wenig plausibel.
Wie das Team um den Planetenwissenschaftler Evan Bjonnes vom Lawrence Livermore National Laboratory aktuell im Fachjournal „Geophysical Research Letters“ (DOI: 10.1029/2025gl116654) berichtet, liefern neue Simulationen nun eine deutlich einfachere Erklärung für das Rätsel: Mithilfe hochentwickelter Computersimulationen von gigantischen Mond-Einschlägen zeigten die Forscher, dass das Gestein höchstwahrscheinlich während der Bildung des Serenitatis-Beckens – einem großen Einschlagskrater auf der Mondvorderseite – an die Oberfläche gelangte.
www.grenzwissenschaft-aktuell.de
+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +
Die Modelle belegen: In der späten „Kollapsphase“ der Kraterbildung kann Material aus Dutzenden Kilometern Tiefe derart sanft nach oben bewegt werden, dass Proben wie 76535 ihre ursprüngliche Struktur und Textur behalten. Auf diese Weise sei das Gestein nur wenige Kilometer unter die Oberfläche gelangt, von wo es dann von Apollo 17 eingesammelt wurde.
„Wir haben nach einer einfachen, lokalen Erklärung gesucht – und die Modelle zeigten immer wieder dasselbe Bild“, erklärt Bjonnes. „Große Einschläge können tiefes Gestein nach oben befördern, ohne es zu zerstören.“
Ein Zeitsprung um 300 Millionen Jahre
Die neue Analyse datiert die Entstehung des Serenitatis-Beckens nun auf etwa 4,25 Milliarden Jahre – rund 300 Millionen Jahre früher als bislang angenommen, und das hat weitreichende Konsequenzen: Auf diese Weise verschiebt sich der gesamte Zeitrahmen der frühen Einschlaggeschichte des Mondes und auch der Erde.
Da die Erde selbst kaum geologische Zeugnisse aus dieser Frühzeit bewahrt hat – Plattentektonik und Erosion haben nahezu alle Spuren getilgt – dient der Mond als wichtigste Referenz. Eine Neudatierung eines so bedeutenden Einschlags bedeutet daher auch eine Neuberechnung der frühen Erdgeschichte, insbesondere was Häufigkeit und Zeitpunkt von Großereignissen betrifft.
„Indem wir Serenitatis in der Zeit zurückverschieben, verschieben wir die gesamte Chronologie großer Einschläge im inneren Sonnensystem“, so Bjonnes. „Das hat unmittelbare Auswirkungen darauf, wie wir die frühe Umwelt der Erde verstehen.“
Mehr als nur ein „Mond“-Rätsel
Die Erkenntnisse unterstreichen den bleibenden Wert der Apollo-Proben. „Es ist erstaunlich, dass diese Gesteine auch nach über einem halben Jahrhundert noch völlig neue Geschichten erzählen“, sagt Bjonnes.
Die Studie liefert zudem Hinweise für künftige Mondmissionen. Astronauten sollten gezielt nach „untypischen“ Gesteinen auf der Oberfläche Ausschau halten. Durch ähnliche Kraterkollaps-Prozesse könnten auch in anderen Becken tief liegende Gesteine erreichbar sein – und weitere Puzzleteile zur Frühgeschichte des Mondes und der Erde liefern.
Die neue Datierung verändert nicht nur unser Bild vom Mond, sondern auch das Verständnis der planetaren Entwicklung insgesamt. Wenn große Einschläge früher stattfanden als bislang angenommen, muss auch die thermische Entwicklung der inneren Planeten neu bewertet werden: Wie schnell kühlten Mond und Erde ab? Wie lange dauerte es, bis stabile Oberflächen und möglicherweise lebensfreundliche Bedingungen entstehen konnten?
„Dieses kleine Gestein trägt eine gewaltige Geschichte in sich“, abschließend Bjonnes abschließend zusammen. „Es ist wie eine Zeitkapsel, die uns einen direkten Blick in die Frühzeit des Sonnensystems erlaubt.“
WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
Apollo-Proben belegen: Der Mond ist mehr als 100 Millionen Jahre älter 20. März 2025
Sauerstoffisotope legen nahe: Der Mond ist ein Stück des Erdmantels 17. Januar 2025
Der Mond könnte älter sein als bislang gedacht 18. Dezember 2024
Paradigmenwechsel: Entstand der Mond doch ganz anders? 28. September 2024
Erde und Mond teilten sich einst ein gemeinsames, schützendes Magnetfeld 17. Oktober 2020
Erdenmond ist fast 100 Millionen Jahre jünger als gedacht 11. Juli 2020
Recherchequelle: Lawrence Livermore National Laboratory, Geophysical Research Letters
© grenzwissenschaft-aktuell.de