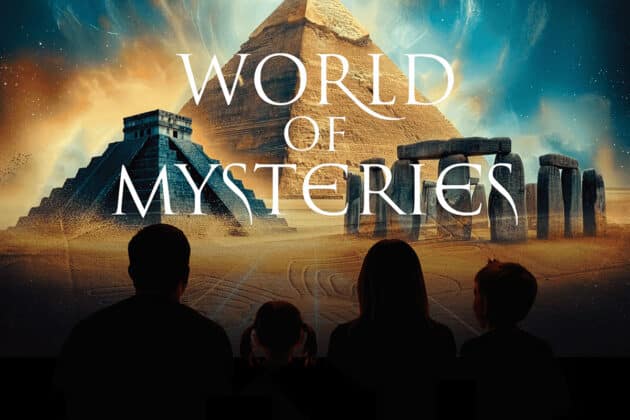Leitfaden zur UFO-Forschung für zivile Astronomen
Stockholm (Schweden) – In einem Grundlagenartikel stellen die Astronomin Beatriz Villarroel und der Astrophysiker Kevin Krisciunas eine Anleitung für zivile Astronomen zur wissenschaftlichen Untersuchung unidentifizierter Flugobjekte und anomaler Phänomene (UFOs/UAP) vor.

Copyright: grewi.de
Inhalt
Villarroel und Krisciunas haben ihre Artikel „A Civilian Astronomer’s Guide to UAP Research“ vorab via ArXiv.org veröffentlicht. Darin argumentieren die beiden Wissenschaftler, dass die Erforschung von UAP bislang durch ein gesellschaftliches Stigma, fehlende systematische Datenerfassung und unzureichende wissenschaftliche Methodik behindert wurde – und fordern darin eine rationale, empirisch fundierte Herangehensweise.
Stigma verhinderte jahrzehntelang eine wissenschaftliche Erforschung
UAP wurden lange Zeit mit spekulativen oder sensationellen Erzählungen verknüpft, sodass viele Wissenschaftler das Thema gemieden haben. Doch durch die jüngsten Enthüllungen, wie die Veröffentlichung von UAP-Videos durch die US Navy und Untersuchungen des US-Verteidigungsministeriums, wird das Phänomen zunehmend ernst genommen. Der Autor und die Autorin betonen, dass es in der Wissenschaft Raum für Hypothesenbildung gibt – auch zu ungewöhnlichen oder bisher unerklärlichen Phänomenen – solange die Herangehensweise methodisch korrekt ist.
Astronomie als Schlüssel
In ihrem Artikel schlagen Beatriz Villarroel vom schwedischen Nordita-Institut und der Universität von Stokholm und Kevin Krisciunas von der Texas A&M University vor, dass Astronomen gezielt Instrumente und Verfahren aus der Astrophysik und Astronomie einsetzen, um UAP zu beobachten: etwa All-Sky-Kameras, Multiwellenlängenfotografie, Spektroskopie oder parallele Beobachtungsteams. Auch bestehende astronomische Archive könnten Hinweise auf bisher übersehene Objekte enthalten.
www.grenzwissenschaft-aktuell.de
+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +
Ein zentrales Anliegen der Autoren ist die Hypothesenbildung: Sie selbst stellen ihre sogenannte „ExoProbe“-Hypothese vor, nach der manche UAP als mögliche autonome, nichtmenschliche Beobachtungseinheiten (z. B. KI-gesteuerte Sonden) interpretiert werden könnten. Dabei dient diese Annahme nicht als faktische Behauptung, sondern als methodisches Hilfsmittel zur Entwicklung überprüfbarer Vorhersagen – etwa über Bewegungsmuster, Energieemissionen oder Reaktionen auf Lichtsignale.
Sorgfaltspflicht auch und gerade bei UAP
Zugleich warnen Villarroel und Krisciunas aber auch davor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Denn: „Viele UAP könnten sich letztlich als irdische Phänomene, etwa Drohnen, Sensorfehler oder atmosphärische Effekte, herausstellen.“ Umso wichtiger sei ein offener, aber kritischer Ansatz, bei dem negative Ergebnisse genauso wertvoll sind wie potenzielle Entdeckungen. Transparenz, Datenfreigabe und wissenschaftlicher Austausch seien unerlässlich, um das Feld zu entmystifizieren.
UFOs, die Amateurastronomie und Bürgerwissenschaft
Besonders betonen die Autoren die Rolle von Amateurastronomen und der Bürgerwissenschaft. Durch günstige Technik, globale Vernetzung und Open-Source-Software könnten engagierte Laien wichtige Beiträge leisten. Sie schlagen auch vor, größere Teleskopanlagen gezielt für koordinierte UAP-Beobachtungseinsätze zu nutzen.
Abschließend plädieren die Autoren dafür, UAP-Forschung als Teil der modernen Astronomie zu begreifen – nicht als Randerscheinung. Denn: „Die Frage, ob es im Kosmos intelligentes Leben gibt oder wir lediglich unsere eigenen Fehlinterpretationen beobachten, ist eine der spannendsten der Wissenschaft. Und um ihr zu begegnen, braucht es Objektivität, Technologie und eine Portion intellektuellen Mut.“
– Den vollständigen Grundlagenartikel im englischen Original finden Sie HIER
Auch in Deutschland werden UFO wissenschaftlich untersucht und an technischen Detektionssystemen gearbeitet. Vorreiter ist hier das „Interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik“ (IFEX) an der Universität Würzburg
+ Fraunhofer Aviation & Space kooperiert mit IFEX bei UAP-Forschung und SETI an der Universität Würzburg 28. Februar 2025
* Internationale UFO-Forscher treffen sich zu UAP-Workshop an der Universität Würzburg 29. Mai 2024
* SkyCAM-6: IFEX installiert neue KI-Kamera zur Erforschung der Hessdalen-Phänomene in Norwegen 29. März 2024
* Universität Würzburg: Erstmals ordentliche Vorlesung über unidentifizierte Himmelsphänomene an deutscher Uni 10. März 2023
* Neue Informationen zu UFO-Untersuchungen und Positionen deutscher Ministerien und Behörden 7. März 2023
* DGLR-Magazin „Luft- und Raumfahrt“ widmet sich akademischer Erforschung unidentifizierter Phänomene im Luftraum (UAP) 24. Februar 2023
* Erste Schritte auf dem Weg zu Einrichtung einer offiziellen deutschen UAP-Forschungsstelle 13. Oktober 2022
* Offene Doktorandenstelle für UAP-Forschung an der Universität Würzburg 20. Juli 2022
* Schriftenreihe über UAP-Studien am IFEX der Universität Würzburg 19. Mai 2022
* Universität Würzburg nimmt UAP/UFOs in den Forschungskanon auf 8. Februar 2022
* SkyCAM-5: Detektionseinheit sucht nach unidentifizierten Himmelsphänomenen über Universität Würzburg 20. Dezember 2021
* Universität Würzburg beteiligt sich an der instrumentellen Erforschung des „Hessdalen-Phänomens“ 6. April 2018Als Amazon-Partner erhält GreWi bei qualifizierten Verkäufen eine Provision. Danke!
WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
Jetzt unterzeichnen: Durham Declaration zu SETI und UAP-Forschung 25. April 2025
Sind heutige Sensortechnologien ausgereift genug, um UFOs/UAP präzise zu erfassen? 3. April 2025
Umfrage unter US-Dozenten zur Stigmatisierung von UFOs in der Akademie 5. August 2024
Recherchequelle: ArXiv.org
© grenzwissenschaft-aktuell.de

 *
*