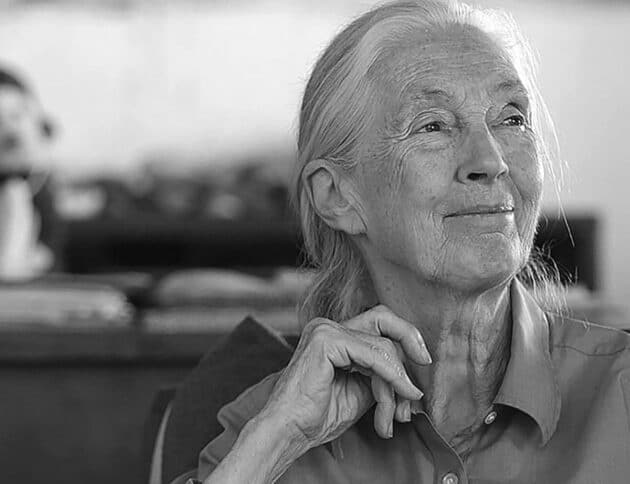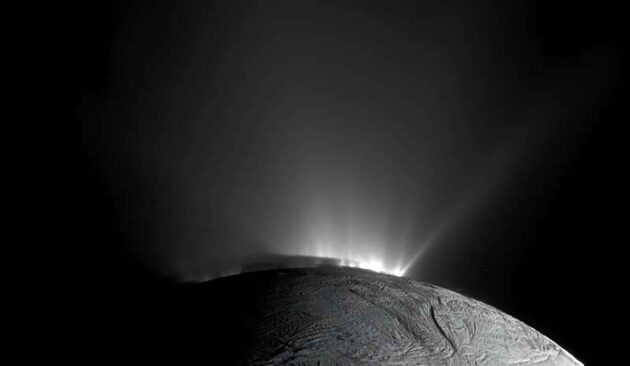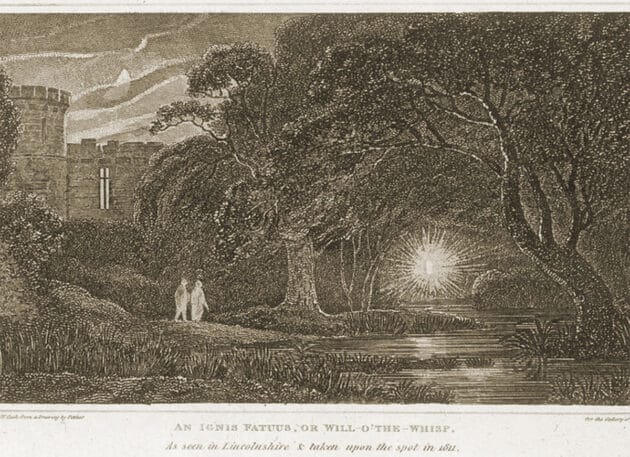Keltische Fürsten in Südwestdeutschland erbten Macht über die mütterliche Linie
Leipzig (Deutschland) – Zwei prunkvolle Fürstengräber aus der frühen Hallstattzeit in Südwestdeutschland werfen ein neues Licht auf die Machtstrukturen frühkeltischer Gesellschaften. Eine aktuelle genetische Analyse belegt: Der soziale Status, selbst jene hochrangiger Männer, wurde offenbar über die Mutterlinie vererbt.

Copyright/Quelle: Aerial video capture (WikimediaCommons) / CC BY-SA 4.0
Inhalt
Wie das Team um Joscha Gretzinger vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie aktuell im Fachjournal „Nature Human Behaviour“ (DOI: 10.1038/s41562-024-01888-7) berichtet, stelle die neue Erkenntnis einen bemerkenswerten Befund dar, der auf eine matrilineare Gesellschaftsstruktur hindeutet und die bisherigen Annahmen über Geschlechterrollen in der Frühgeschichte infrage stellt.
Zwei Grabhügel im Zentrum der Forschung
Im Zentrum der Studie stehen zwei reich ausgestattete Grabhügel, nur rund zehn Kilometer voneinander entfernt: Eberdingen-Hochdorf und Asperg-Grafenbühl, beide nahe Stuttgart. Die dort bestatteten Männer waren offenbar nicht nur zwei der mächtigsten, sondern vermutlich auch größten Männer ihrer Zeit. Zudem zu Lebzeiten muskulös gebaut, wurden die beiden vermutlichen Fürsten mit goldenen Trinkhörnern, Gewändern, Bernstein, Elfenbein und anderen Luxusgütern in den zudem bis zu 6 Meter hohen und rund 40 bzw. 60 Meter durchmessenden Grabhügeln bestattet. Ihr hoher sozialer Rang war offenkundig.

Copyright/Quelle jnn95 (WikimediaCommons) / CC BY-SA 3.0
Neue archäogenetische DNA-Analysen von insgesamt 31 Personen aus Gräbern der Region zeigen nun: Die beiden Fürsten waren miteinander verwandt – und zwar wahrscheinlich über die mütterliche Linie. Die genetischen Daten lassen auf eine sogenannte matrilineare Avunkulatserbfolge schließen: Der jüngere der beiden Männer war sehr wahrscheinlich der Neffe des älteren – also der Sohn von dessen Schwester.
Vererbung von Macht über die mütterliche Linie
„Das ist ein faszinierender Fund“, sagt der an der Studie ebenfalls beteiligte Genetiker Stephan Schiffels vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Zwar liefere die allein keinen exakten Verwandtschaftsgrad, aber dendrochronologische Daten der hölzernen Grabkammern und Isotopenanalysen der Knochen untermauern die These einer matrilinearen Erbfolge. Beide Männer wuchsen im selben Gebiet auf, wurden aber etwa 50 Jahre nacheinander geboren.
Hintergrund
Die Hallstattkultur, benannt nach einem Ort in Österreich, war zwischen 700 und 400 v. Chr. nördlich der Alpen verbreitet. Ihre Siedlungen erreichten beeindruckende Größen, waren befestigt und kulturell hochentwickelt. Die reichen Handelskontakte reichten von der Ostsee bis ins Mittelmeer. Die monumentalen Grabhügel – bis zu 100 Meter im Durchmesser und über sechs Meter hoch – zeugen vom Reichtum und der gesellschaftlichen Komplexität dieser Kultur.
Weitere Funde aus der Region stützen diese Interpretation: In einem dritten Grabhügel war eine Frau im Zentrum bestattet, ein junger Mann mit ähnlichem mitochondrialem Erbgut ebenfalls – was wiederum auf eine mütterliche Verbindung hinweist.
Dass Macht durch Frauen vererbt wurde, steht im Gegensatz zu gängigen Vorstellungen über die patriarchalen Strukturen antiker Gesellschaften. „Matrilineare Systeme sind in der modernen Welt äußerst selten“, zitiert der „ScienceAdviser“ die nicht an der Studie selbst beteiligte Archäologin Ursula Brosseder vom Leibniz-Zentrum für Archäologie. Der neue Befund sei daher „absolut bemerkenswert“.
www.grenzwissenschaft-aktuell.de
+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +
Auch antike Texte stützen diese Interpretation: Der römische Historiker Titus Livius schrieb im 1. Jahrhundert v. Chr., dass ein keltischer König seine Nachfolge an die Söhne seiner Schwester weitergab. Ein weiteres Indiz für ein matrilineares System in der keltischen Welt.
Gründe könnten vielfältig sein
Warum eine solche Erbfolge bevorzugt wurde, bleibt indes offen. Einer der Gründe mag in dem Umstand liegen, dass die biologische Abstammung über die Mutter, im Gegensatz zu jener bei Vätern, stets sicher ist. Allerdings ist von anderen bekannten matrilinearen Kulturen, wie etwa bei den Irokesen Nordamerikas, bekannt, dass dieses Modell meist unabhängig von der Frage der Vaterschaft entwickelt wurde. Vielmehr könne es sich um eine alternative Denkweise zu Verwandtschaft und Macht handeln.
Die Gräber zeigen zudem, dass es neben biologischen auch soziale Verbindungen zwischen den Bestatteten gab: Um die Fürstengräber selbst finden sich weitere Bestattungen, darunter Frauen mit Kindern, die genetisch nicht ihre eigenen waren. Daraus schließen die Forschenden, dass Kinder möglicherweise in Pflegefamilien großgezogen wurden und später mit diesen beerdigt wurden, etwa als Zeichen politischer Allianzen.
WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
Studie widerlegt stereotype Vorstellung von Männern als Jägern und Frauen als Sammlerinnen 29. Juni 2023
Schwer fassbare Minderheiten: Studie zu nicht-binären Geschlechterrollen im prähistorischen Europa 26. Mai 2023
Schon in der Bronzezeit wurde auch Kinder geschlechtsspezifisch bestattet 6. Februar 2022
DNA-Analyse der „Frau mit Schwert“ zeigt: In nordisch-mittelalterlichem Grab lag ein Zwitter 3. August 2021
DNA-Studie offenbart falsche Vorstellungen über Wikinger 29. September 2020
Grund für Wohlstand: Wikingerfrauen waren den Männern nahezu gleichgestellt 4. November 2019
Recherchequelle: Nature, Science Adviser
© grenzwissenschaft-aktuell.de